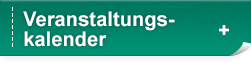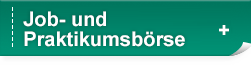Kolumne Baukultur #5
Der Stoff, aus dem Erinnerungen gemacht sindVom Wert einer ganzheitlichen Architektursprache
von Anne-Sophie Woll
Ich vermisse sie: Diese Architektur, die weniger mit dem Kopf als mit den Händen, Füßen, Ohren und der Nase geplant wurde. Diese Gebäude, die so viel zu erzählen haben, auch wenn wir die Augen schließen. Vielleicht ist es eine melancholische Kindheitsverklärung, vielleicht aber auch der Schlüssel zum Planen und Bauen, das berührt, das bei den Menschen ankommt – das bleibt.
Kommen wir zu dem, was bleibt: Ich erinnere mich noch bis heute an das Gefühl, das mich durchströmte, wenn ich das Schulhaus betrat. Wenn ich die schwere Holztür, mit der für Kinderhände viel zu großen Klinke, überwunden hatte, kam ich auf die breite Treppe zu. Sie war so ausgetreten und schief, dass, wenn man nicht gerade am Rand ging, jederzeit das Gefühl hatte, das Gleichgewicht zu verlieren. Dieser Effekt wurde noch verstärkt, je mehr Schüler gleichzeitig nach oben gingen. Begleitet wurde die Unsicherheit von dem Widerhall des Knarrens des Holzes und der vielen Schuhe im hohen Treppenhaus. Auf dem Treppenabsatz angekommen hatte ich wieder festen Boden unter den Füßen, Platz um mich und wurde von einem hellen Licht umfangen, das durch die großen Fenster einströmte. Voller Spannung auf den vor mir liegenden Tag suchte ich das Klassenzimmer auf. Diese weiten Räume, in denen sich der Geruch von sonnenerwärmtem Holz und Bohnerwachs mit dem von Tafelkreide mischten. Angekommen am Sitzplatz, konnte Ruhe einkehren.
Diese Darstellungen ließen sich fortführen. Es wäre zu lesen von kühlen, dunklen Werkräumen im Souterrain, die etwas feucht rochen und deren Mauern einen sicher umschlossen. Von einem Schulbüro, in dem man durch das eintretende Mittagslicht so geblendet wurde, dass man sich ein bisschen vorkam, als stünde man in einer anderen Welt. Von einem Kopfsteinpflaster auf dem Schulhof, das so uneben war, dass jedes Fangspiel zu einem Hindernisparcours wurde. Oder von einem Park, der so ausgedehnt war, dass er für die Pausennutzung gesperrt wurde, weil zu viele Kinder nicht pünktlich zur nächsten Stunde erschienen.
Nun, was sollen diese Beschreibungen und wie nehmen sie Einfluss auf unser Planen und Bauen? Ich denke, dass wir beim Umschiffen aller Hindernisse der Planung, beim Integrieren aller anzuwendenden Normen und beim Ausloten der Anforderungen manchmal aus dem Fokus verlieren, für wen wir planen. Wir erstellen großartige Visualisierungen unserer Pläne und überzeugen damit uns und unsere Auftraggeberinnen und Auftraggeber. Aber es geht auch darum, einmal den Standpunkt zu wechseln: Wie fühlt sich der Handlauf an? Welchen Geruch verströmt der neue Bodenbelag? Und nicht zuletzt, wie klingt ein Raum eigentlich?
Wir nehmen unsere Umgebung mit allen Sinnen war, doch leider beschränkt sich die Planung zu häufig auf rational nachvollziehbare und sichtbare Kriterien. Dabei ist jede gebaute Umwelt zugleich auch ein Träger von Emotionen und Erinnerungen. Vielleicht sollten wir dieser Tatsache einen größeren Stellenwert in unserer Arbeit einräumen. Schließlich basiert unser Menschsein im Wesentlichen darauf, dass wir auf allen Ebenen und mit allen Sinnen in Kontakt mit unserer Umwelt treten: körperlich, geistig und emotional. Die Umgebung besitzt einen tiefgreifenden Einfluss auf unser (Wohl-)befinden und wir können uns ihr nicht entziehen: Dieser Verantwortung sollten wir gerecht werden.
Was macht eine Gestaltung aus, die weniger „instagrammable“ und dafür ganzheitlicher ist? Sie bietet die Chance für all unsere Bilder der Erinnerungen und unsere zukünftigen Handlungen, ein positiver Rahmen zu sein. Lasst uns Rahmen schaffen, die auch mit geschlossenen Augen ihre Bestimmung nicht verfehlen!